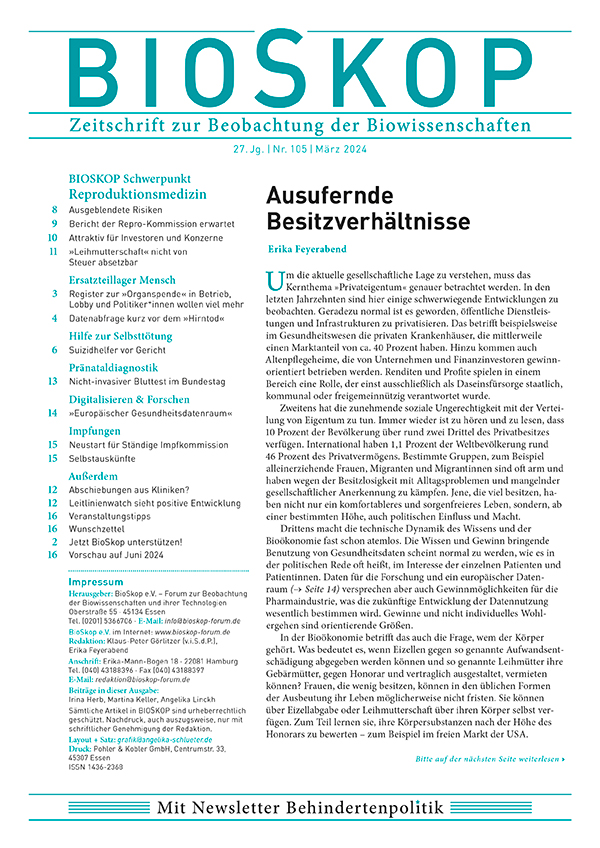Zielstrebige Gespräche
Wie erleben und verstehen PatientInnen, denen eine Einwilligungserklärung vorgelegt wird, den Prozess der Zustimmung? Und wie verhalten sich dabei ÄrztInnen, ForscherInnen und Pflegekräfte? Fragen, die ein Team um die Wissenschaftsforscherin Ulrike Felt im Allgemeinen Krankenhaus Wien eingehend untersucht hat. An der Abteilung für Wiederherstellungs- und Plastische Chirurgie beobachteten Professorin Felt und ihre KollegInnen zwischen September 2005 und März 2006 so genannte »Informed-Consent«-Gespräche zwischen ForscherInnen des Klinischen Instituts für Pathologie und 34 PatientInnen, denen am Folgetag im Zuge von Operationen Haut entfernt werden sollte. In diesen Gesprächen wurden PatientInnen gebeten, per Unterschrift zu erklären, dass sie entnommene Haut für Forschungszwecke zur Verfügung stellen.
Im Anschluss an die teilnehmende Beobachtung interviewte das Felt-Team die PatientInnen, um herauszufinden, wie sie den Prozess von Aufklärung und Einwilligung erfahren hatten. Außerdem sprachen die WissenschaftsforscherInnen mit MedizinerInnen, PflegerInnen und anderen Personen, die mit Einwilligungserklärungen zu tun haben. Reflexionsworkshops mit den Beteiligten, zu denen auch ExpertInnen aus Recht, Ethik, Medizin und Sozialwissenschaften eingeladen wurden, gehörten ebenfalls zu der Studie, die vom österreichischen Wissenschaftsministerium gefördert wurde.
Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Health veröffentlicht.
Versuche am Menschen
Berichte, Hintergründe, Analysen
ULRIKE FELT, Professorin für Wissenschaftsforschung an der Universität Wien
»Informierte Einwilligung« und »institutionelle Körpersprache«
- Medizinrecht und Alltag
aus: BIOSKOP Nr. 43, September 2008, Seiten 12-14
Einverständniserklärungen, in Fachkreisen »Informed Consent« oder »informierte Einwilligung« genannt, haben sich im medizinischen Alltag kontinuierlich ausgebreitet und sind juristisch verbindlich geworden. Zu solchen Erklärungen werden Patienten vor Eingriffen wie Operationen oder Entnahmen von Körpersubstanzen ebenso aufgefordert wie Probanden, die an biomedizinischen Forschungsprojekten teilnehmen sollen. Das medizinisch-juristische Einwilligungskonzept hat Ärzten und Patienten neue Rollen zugewiesen. Bisweilen basieren sie auf erstaunlich stereotypen Idealvorstellungen.
Ärzte sind verpflichtet, Informationen über einen beabsichtigten medizinischen Eingriff bzw. über ein Forschungsvorhaben »angemessen«, also verständlich und in einem der Komplexität entsprechenden Zeitrahmen zu vermitteln. Von Patienten wird erwartet, dass sie diese Information bewusst suchen, sie bereitwillig aufnehmen und – auf dieser Basis – eigenverantwortlich entscheiden.
Welche Art von Information von den Beteiligten wie verstanden und verhandelt wird, haben wir im Rahmen eines Forschungsprojekts untersucht. Konkret ging es um Patienten, die von Wissenschaftlern darum gebeten wurden, Teile ihrer Haut, die bei einer bevorstehenden Operation »übrig bleiben«, für medizinische Grundlagenforschung zur Verfügung zu stellen. Während bislang die meisten Studien zum Informed Consent zu ermitteln suchten, was und wie viel Patienten bei diesen Informationsprozessen tatsächlich verstanden haben, waren die Fragen in unserem Projekt etwas anders gelagert: Wie gehen Patienten überhaupt mit der erhaltenen Information um? Welche Rolle nimmt sie in ihrer Entscheidung ein? Und schließlich: Welche anderen Wissens- und Erfahrungselemente erhalten eine relevante Position?
- Zur Relation von Wissen und »rationaler« Entscheidung
Debatten rund um Phänomene wie Informed Consent sind in einen breiteren gesellschaftlichen Wandel eingebettet, den man mit dem Begriff »Wissensgesellschaft« wohl am besten umschreiben könnte. Wissen sowie Entscheidungen, die auf Wissen basieren, rücken ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Gerade bei Themen, die einen Zusammenhang zu Gesundheit oder dem menschlichen Körper aufweisen, wird dies besonders deutlich. Der eigenverantwortlich vorsorgende Patient ist zu einer zentralen Diskursfigur geworden, ebenso wie evidenzbasiertes medizinisches Wissen, das als Garant für »gute Information« gesehen wird. Dass auf diese Weise nur ein bestimmter Blick auf den menschlichen Körper und damit auch nur bestimmtes Wissen über ihn zugelassen wird, bleibt jedoch weitgehend unthematisiert.
Mit diesem eher normativen Blick auf relevantes Entscheidungswissen geht vielfach auch eine »Verrechtlichung« von Prozessen im Medizinsystem Hand in Hand. Bei einem Informed Consent geht es also zum einen um die »geeignete Information«, aber auch darum, wie diese zu vermitteln ist, damit sie im Konfliktfall juristisch standhalten kann. Im von uns untersuchten Fall lag als Einverständniserklärung ein sechs Seiten langes Dokument vor. Es enthielt Aussagen über den Forschungszusammenhang, in dem die überlassene Haut verwendet werden soll. Der Vordruck zur Einwilligung hob die Risikolosigkeit der Spende für den Patienten hervor, strich die Tatsache heraus, dass kein Gewinn für ihn zu erwarten sein werde und sicherte Datenschutz zu. Diese Ausführungen soll der Patient auf jeder Seite unterschreiben und so bestätigen, dass er die vorgelegte Information verstanden und in die Teilnahme am Projekt eingewilligt hat.
- Von Wissens- zu Sinngeschichten: Der Blickwinkel der Patienten
Nicht ganz unerwartet fügen sich die von uns beobachteten Patienten kaum in das über sie produzierte Klischee. Auf die Operation wartend, las die überwältigende Mehrheit das Formular kaum und stellte auch so gut wie keine Fragen. Vielmehr folgten die Patienten den kurzen, mündlichen Ausführungen des Arztes, wobei das Formular eher eine symbolische Funktion in der Kommunikation zwischen Arzt und Patient einzunehmen schien. Schließlich unterschrieben alle die Einwilligung zur wissenschaftlichen Verwendung ihrer Haut.
Was sind nun einige der wesentlichen Elemente, die zu dieser so einhelligen Entscheidung beitrugen? Was sind die Sinngeschichten, die von den Patienten rund um die Zustimmung konstruiert wurden? Zum ersten entwickelten sie eine spezifische Wahrnehmung des Medizinsystems, die in einem Spannungsverhältnis zu dem Entwurf steht, den das Einwilligungsformular anbietet. Während dort ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass das Überlassen der Haut mit keinerlei Gewinnmöglichkeit für sie verbunden ist, skizzierten die Patienten eine längerfristige Sicht auf das Medizinsystem. Verankert in einem Geschenks- und Solidaritätsdiskurs, sahen sie ihre eigene Chance auf Behandlung als Resultat der früheren Bereitschaft anderer Patienten, an Forschungsprojekten mitzuwirken. Also wäre es nun an ihnen selbst, diesen Beitrag zum Funktionieren des Systems zu leisten und damit den Gewinn für zukünftige Generationen sicherzustellen. Dabei geben sie auch immer wieder ihrer Vorstellung Ausdruck, dass es wohl genügend andere – uniformierte, uninteressierte, unverantwortliche – Patienten gebe, die diesen Weitblick nicht haben und ihre Haut nicht der Forschung zukommen ließen.
Ein zweites wesentliches Element waren ihre Vorstellungen über Wissenschaft und insbesondere medizinische Innovation, welche ziemlich uneingeschränkt positiv und unterstützenswert porträtiert wurde. In den Erzählungen der interviewten Patienten ging es meist um stufenweisen, stetigen Fortschritt, der uns langsam zu immer besseren Lösungen führen werde. Und obwohl die Forscher immer wieder hervorhoben, dass es sich bei ihrem Projekt um Grundlagenforschung handelt, wurde dieses Faktum von den Befragten quasi ausgeblendet – und der potentielle Anwendungscharakter zum entscheidenden Merkmal in der Entscheidung.
Schließlich ordneten die Patienten sowohl den Prozess des Einholens der Einverständniserklärung, als auch ihre Zustimmung klar in medizinische Systemroutinen und als Ausdruck einer »institutionellen Körpersprache« ein. Zeitmangel oder hierarchische Wissensverhältnisse waren integraler Bestandteil dieser Körpersprache. Sich in diese Routinen einzufinden, trug damit aus ihrer Sicht in einer pragmatischen Weise zum Erhalt und zum Funktionieren des Systems bei; Ausbrechen daraus würde den reibungsfreien Lauf gefährden. »Einverständniserklärungen« wurden daher auch kaum als Schutz für den Patienten gesehen, sondern eher als Absicherung der medizinischen Einrichtung, Beitrag zum Funktionieren einer effizient laufenden Maschinerie. Lieber nicht nachzufragen, sondern aus den eigenen Abwägungsmechanismen heraus zustimmend zu entscheiden, wurde daher als eine durchaus »vernünftige«, zweckrationale Haltung gesehen.
- Grundlegende Spannungsfelder
Damit wurden in der Analyse der _Informed-Consent_-Prozesse wesentliche Spannungsfelder offensichtlich. Der grundlegende, im Medizinsystem verankerte Gedanke, dass Entscheidungen nur auf Basis von medizinischer Information getroffen werden sollten, wurde von den Patienten insofern unterlaufen, als sie – der Pragmatik der Situation Rechnung tragend – auf Basis ihrer eigenen Vorstellungen Einschätzungsroutinen entwickelten. Eine Rolle spielten dabei Erfahrungen, die sie aus unterschiedlichen Kontexten übersetzten. Fern von der im konkreten Fall erhaltenen Information, sahen Patienten ihre Entscheidung eingebettet in eine Systemlogik, aus der sie sich gerade vor einer Operation nur schwer entziehen konnten.
Schließlich baut der medizinische Diskurs rund um den Informed Consent sehr stark auf der Vorstellung, dass Patienten medizinische Information als Basis für eine Entscheidung haben und damit auch Verantwortung explizit übernehmen wollen. Dabei wird ausgeblendet, dass die Bereitschaft zum Übertragen der Entscheidung und Verantwortung an das Medizinsystem von manchen Patienten als ein möglicher, pragmatischer Umgang mit einem allzu verrechtlichten System verstanden wurde, in dem sie ohnehin kaum Handlungsraum sehen.
Und was bedeutet dies für die Praxis des Informed Consent? Alle gefragten Patienten haben ihre Haut für die Forschung zur Verfügung gestellt, es wurde kein offensichtlicher Druck ausgeübt und die Forschung konnte sich weiterentwickeln. Gibt es also überhaupt ein Problem?
- Einverständnis als Technologie
Ideal und Praxis im Krankenhaus klaffen bei der Einverständniserklärung weit auseinander. Man könnte meinen, das Formular sei im Grunde ungeeignet und entspreche nicht den Notwendigkeiten und Erwartungen der Patienten – weshalb vor allem der Prozess des Einholens von Einwilligungen anders gestaltet werden müsste. Eine solche Verbesserung würde sicherlich bis zu einem gewissen Grad Sinn machen. Doch im Grunde geht es nicht nur darum, die Aufklärung zu verbessern. Was nämlich in den Debatten rund um Informed Consent vielfach übersehen wird, ist die Tatsache, dass Bürger/Patienten ihre eigenen Arten und Weisen zu wissen haben, nach denen sie Beurteilungen vornehmen. Diese sind stark kulturell geprägt. Wissen, Strukturen und Entscheidungsmöglichkeiten werden als miteinander verwoben wahrgenommen. Bürger verstehen und erleben sich gerade nicht als autonome Entscheidungsträger – in einem hierarchisch organisiertem Medizinsystem, mit einer auf Expertenwissen fokussierten Entscheidungsfindung und in einer sehr auf Konsens ausgerichteten Gesellschaft. Das ist die unsichtbare Basis des Informed Consent. Darüber hinaus ist es wesentlich, das von Patienten immer wieder »geübte« Geben von Einverständnis als eine Technologie zu verstehen, die eine Vorstellung von Gemeinschaft und von gutem und richtigem Verhalten etabliert. Ein »guter«, »rationaler« Patient bestätigt, dass er ausreichend informiert wurde und willigt ein – so jedenfalls die gängige Interpretation der Patienten.
Daher müssten doch vielmehr andere Fragen in den Fokus rücken: Welche Bereiche unseres Lebens wollen wir eigentlich dieser Form der Rationalisierung und Regulierung unterziehen? Wie schaffen wir Räume der Auseinandersetzung, in denen Expertise nicht nur auf der Seite der Mediziner vermutet wird? Wie können Wissen und Erfahrungen der Patienten wahrgenommen und eingebunden werden, in die Entscheidungsprozesse und in notwendige, systemische Veränderungen der klinischen Forschung? Im Grunde geht es darum, neue, medizinische Möglichkeitsräume zu gestalten und die vorherrschende »institutionelle Körpersprache« zu verändern.
© Ulrike Felt, 2008
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Autorin