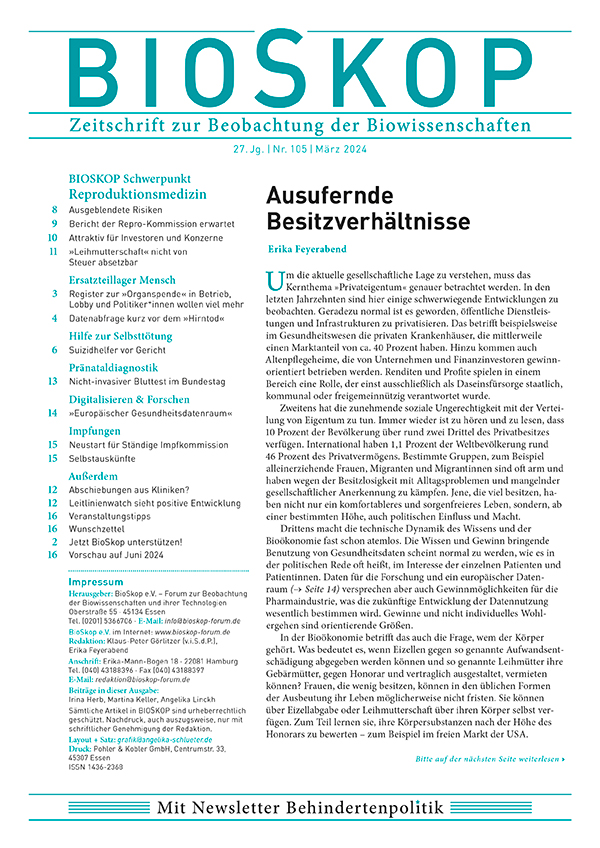»Änderungsbedarf«
Die Ständige Kommission Organtransplantation der Bundesärztekammer spielt eine Schlüsselrolle: Sie gibt regelmäßig Empfehlungen, beispielsweise zur Spende, Vermittlung und Verteilung von Organen; sie berät Politik, Gesundheitsverwaltungen, Kostenträger und medizinische Einrichtungen; die breite Öffentlichkeit soll sie auch informieren. Vorsitzender des Gremiums ist kein Mediziner, sondern ein Jurist: Hans Lilie, Professor für Strafrecht an der Uni Halle in Sachsen-Anhalt.
Kurz vor Weihnachten ereignete sich Bemerkenswertes: In einem Interview mit dem Deutschen Ärzteblatt räumte Lilie »Änderungsbedarf« hinsichtlich seiner Kommission ein und erklärte: »Ihre Arbeit sollte etwas stärker formalisiert werden. Der Gesetzgeber hat wenig zur Richtlinienerstellung geregelt, und es wäre mir ein Anliegen, wenn die Ständige Kommission Organtransplantation die Transparenz der Tätigkeit stärken könnte. Sie sollte zum Beispiel – ähnlich wie der Gesetzgeber bei Gesetzesvorlagen – Richtlinienentwürfe publizieren, damit die interessierte Öffentlichkeit zeitnahe Informationsmöglichkeiten hat.«
Klaus-Peter Görlitzer (März 2010)
BioSkop-Dossier
»DSO auf dem Prüfstand«
Transplantationsrecht: Kompliziert gesponnenes Netz
HEINRICH LANG, Professor für Öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht an der Universität Greifswald
Kompliziert gesponnenes Netz
- Das Transplantationsgesetz sollte Transparenz und Kontrolle ermöglichen – dieser Versuch ist gescheitert
aus: BIOSKOP Nr. 49, März 2010, Seiten 14+15
Das Transplantationssystem setzt auf Selbstlosigkeit und Vertrauen der Bürger. Wesentliche Voraussetzungen sind Transparenz und Kontrolle. Eine Analyse aus juristischer Perspektive verdeutlicht: Strukturen und Verantwortlichkeiten sind für die Öffentlichkeit kaum durchschaubar.
Als das Transplantationsgesetz (TPG) formuliert wurde, war man sich der besonderen Bedeutung transparenter Strukturen und Entscheidungsströme vollauf bewusst. In wesentlichen Fragen trägt das seit Ende 1997 geltende TPG freilich einen der Transparenz wenig förderlichen Kompromisscharakter – zum Beispiel in der Frage der Todesdefinition. Dennoch wurde das neue Gesetz mit dem Versuch begründet, Vertrauen, Transparenz und Kontrolle in einem bis dato gesetzlich weitgehend ungeregelten Bereich zu schaffen. Man wird nicht umhin kommen, diesen Versuch als gescheitert zu betrachten.
Das TPG legitimiert ein überaus kompliziert gesponnenes Netz von Kooperationsmustern und Entscheidungsprozessen öffentlich-rechtlicher und privater Rechtsträger. Beteiligt sind:
- die Transplantationszentren (TZ). Sie verfügen über das Implantationsmonopol und entscheiden auch über die Aufnahme von Patienten auf die Warteliste (§ 10 II TPG). Obgleich nicht zwingend in öffentlich-rechtlich Trägerschaft stehend, üben die TZ insoweit Tätigkeiten verteilender Verwaltung aus.
- Eurotransplant (ET). Die privatrechtliche Stiftung niederländischen Rechts, ansässig in Leiden, fungiert als Vermittlungsstelle i.S.v. § 12 TPG; sie besitzt das Organvermittlungsmonopol. Beauftragt ist ET von den Spitzenverbänden der Krankenkassen, der Bundesärztekammer und der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
- die Bundesärztekammer (BÄK). Sie ist verfasst als nicht rechtsfähiger Verein bürgerlichen Rechts, durch § 16 TPG ist ihr eine zentrale Funktion zugewiesen. Die BÄK soll in Richtlinien, die der Staat nicht genehmigen muss, den Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft feststellen – nicht nur, aber auch hinsichtlich der Regeln zur Organvermittlung nach § 12 III 1 TPG.
Dieser Paragraph spricht davon, die vermittlungspflichtigen Organe seien von der Vermittlungsstelle (ET) nach Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprächen, insbesondere nach Erfolgsaussicht und Dringlichkeit, für geeignete Patienten zu vermitteln. Ungeachtet der insoweit verharmlosenden gesetzlichen Formulierung stellen die BÄK-Richtlinien in Wahrheit nicht fest, tatsächlich legen sie fest. Und ihr Gegenstand sind nicht wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern Gerechtigkeitsfragen, die eben nicht unter Zuhilfenahme allein medizinischer Kriterien beantwortet werden können.
An einer Organtransplantation sind recht viele Organisationen beteiligt – neben TZ, ET und BÄK auch die DSO, zuständig für die Koordinierung der Organspenden. Dies wäre vielleicht nicht weiter schlimm, wenn Tätigkeiten und Befugnisse der Akteure durch eine eindeutige normative Vorsteuerung gekennzeichnet und vor allem auch für die Bürger erkennbar wären. Gerade bei der konkreten Entscheidung über die Verteilung von Organen ist dies aber weitestgehend nicht der Fall. Das Gesetz begnügt sich damit, (tendenziell gegenläufige) Auswahlkriterien zu fixieren und überlässt nicht nur die Feinsteuerung, sondern auch die Festlegung wahrhaft existentieller Entscheidungskriterien und -ströme in einem Konzept »regulierter Selbstregulierung« den beteiligten Institutionen und namentlich der BÄK.
- Gegenläufige Kriterien
Unter Verfassungsrechtlern ist kaum noch bestritten, dass die Regeln zur Organvermittlung im TPG (§§ 12 III 1, 10 II Nr. 2), insbesondere die Verwendung der tendenziell gegenläufigen Kriterien der Erfolgsaussicht und der Dringlichkeit, einer verfassungsrechtlichen Prüfung weder mit Blick auf den Parlamentsvorbehalt noch das Bestimmtheitsgebot standhalten. Auch verfehlt die in Form der Richtlinientätigkeit seitens der BÄK ausgeübte Staatsgewalt die Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht legitimatorisch an Ausübung staatlicher Gestalt stellt. Doch damit nicht genug. Aufgrund der geschaffenen gesetzlichen Grundlagen und der gewählten institutionellen Arrangements versagen die klassischen rechtsstaatlichen Kontrollmittel der Aufsicht und des Rechtsschutzes.
Man mag dem Gesetzgeber zugutehalten, dass die Einschaltung verschiedener Institutionen und die Verzweigung von Kompetenzen dem Versuch entsprangen, Entscheidungen zu dezentralisieren und wechselseitige Kontrollen zu ermöglichen. Nur, ist man dann gut beraten, eine selbst von Befürwortern der gegenwärtigen Ausgestaltung des Systems als defizitär bezeichnete, (nur) vertraglich verankerte Selbstkontrolle zu etablieren, die es im Wesentlichen den beteiligten Institutionen selbst überlässt, auf Verstöße zu reagieren? Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum ist dazu konstatiert worden, dass sich Verantwortlichkeiten nicht nur faktisch, sondern auch normativ bis zur Unkenntlichkeit verflüchtigen.
- Defizitäre (Selbst-)Kontrolle
Einer der profundesten Kenner des Transplantationsrechts hat konstatiert, mit Hilfe von Fallbeispielen ließen sich komplexe Probleme anschaulich machen und dabei auf den zuvor schon in Fachzeitschriften diskutierten »Berliner Fall« hingewiesen. Im Januar 2006 wurde bei einem Mann in Berlin der Hirntod festgestellt, so dass die medizinische Voraussetzung für eine Organspende vorlag. Seine Familie teilte daraufhin mit, es sei sowohl im Sinne des Hirntoten als auch in ihrem Sinne, dass Organe zur Transplantation entnommen würden – allerdings unter der Bedingung, dass die Ehefrau eine Niere ihres verstorbenen Mannes erhalte. Die Ehefrau war dialysepflichtig und seit fünf Jahren auf der Warteliste für eine Nierentransplantation. Zwar hatte der Ehemann ihr zu Lebzeiten angeboten, eine seiner Nieren zu spenden; sie hatte dies aber aus Sorge, ihn gesundheitlich zu gefährden, abgelehnt. Wie also verfahren?
Das Gesetz ist ebenso eindeutig wie das Dilemma offensichtlich: Verweigert man sich dem Ansinnen der Angehörigen, werden dem System überhaupt keine Organe zugeführt, gibt man dem Begehren nach, verstößt man gegen das Gesetz, das eine zielgerichtete Spende von Organen Hirntoter nicht erlaubt. In einem so im TPG nicht vorgesehenen Entscheidungsverfahren kamen die Leitung der DSO, die Vorsitzenden der bei der BÄK gebildeten Ständigen Kommission Organtransplantation sowie ET überein, am Gesetz vorbei eine Niere der Ehefrau zuzuteilen und die weiteren entnommenen Organe über die Vermittlungsstelle zu verteilen.
Es ist hier nicht der Ort, diese Vorgehensweise in Bausch und Bogen zu verurteilen, sie ist menschlich durchaus verständlich. Nur ist sie eines nicht: rechtmäßig. Aus meiner Sicht hätte es der Transplantationsmedizin gut getan, wenn die beteiligten Entscheider das offen eingeräumt hätten, um dann womöglich die Konsequenzen zu ziehen, die im Rechtsstaat geboten sind, wenn Entscheidungsträger aufgrund innerer Bindungen gegen das geschriebene Recht verstoßen.
Der statt dessen unternommene Versuch, die am Gesetz vorbei getroffene Zuteilung unter Berufung auf das strafrechtliche Notwehrrecht zu rechtfertigen, greift zu wackeligen Krücken und ist jedenfalls aus öffentlich-rechtlicher Perspektive kaum haltbar. Eine fehlende (öffentlich-rechtliche) Befugnisnorm ist nicht schlicht unter Hinweis auf das strafrechtliche Notwehrrecht ersetzbar.
- Rechtsstaatlich unbefriedigend
Aus Platzgründen hier nur ein Hinweis: Trüge die Berufung auf strafrechtliche Notwehrtatbestände nicht nur hinsichtlich der persönlichen Verantwortlichkeit der handelnden Personen, sondern auch hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der am Gesetz vorbei getroffenen Zuteilungsentscheidung, stellte sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Normierung des gesamten TPG. Wozu Organentnahme- und Übertragungsvoraussetzungen und -modalitäten regeln, wenn differenzierte Regelungen in Gesetz und Richtlinien doch jederzeit unter Berufung auf strafrechtliche Notwehrtatbestände ausgehebelt würden?
Dass sämtliche beteiligten Institutionen ebenso wie die Aufsicht zum »Berliner Fall« geschwiegen oder die gewählte Vorgehensweise mehr oder minder stillschweigend gebilligt haben, mag menschlich verständlich sein; rechtsstaatlich ist es indes unbefriedigend. Geht man tatsächlich davon aus, dass praktische Beispiele komplexe Probleme deutlich machen, so demonstriert der Fall, dass sich die im Transplantationsgeschehen agierenden Entscheider über das geschriebene Recht hinwegsetzen, wenn sie dies für geboten und für nachvollziehbar halten. Im Rechtsstaat wirkt aber in erster Linie die Rechtstreue berufener Entscheidungsträger vertrauensbildend.
- Fazit
Was also wäre zu raten? Was immer zu raten ist, wenn sich Misstrauen und Verdacht etabliert haben: Transparenz. Aus meiner Sicht müssten der Gesetzgeber und die beteiligten Institutionen in einen vor allem auch die Patienten wie die Gesellschaft als Ganze beteiligenden, offenen Diskurs darüber eintreten, wer nach welchen Kriterien in der Transplantationsmedizin über die Zuteilung knapper Güter entscheidet. Insoweit könnte das Transplantationssystem eine Vorreiterrolle einnehmen – in der Debatte eines Problems, das ebenso zielsicher wie weitgehend ausgeblendet mit voller Wucht auf das gesamte System der Krankenversorgung zurollt.
© Heinrich Lang, 2010
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Autors